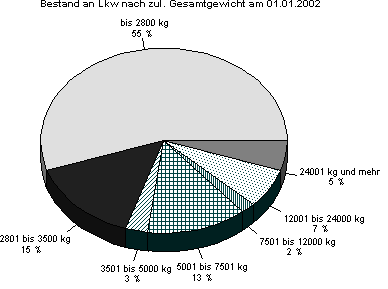
Lastkraftwagen
und Sattelzugmaschinen –
Ein
Rückblick auf die letzten 50 Jahre Straßengüterverkehr
Flensburg, 26.07.2002.
Eigentlich merkwürdig, die breite Bevölkerung erkennt zwar den Wert der
Versorgung durch Lastzüge in der ganzen Bedeutung an, aber dennoch will sie vom
Nutzfahrzeug am liebsten nichts hören und sehen. Dabei ist der Lkw inzwischen
auch schon über 100 Jahre alt; denn bald nachdem die ersten Motorkutschen ihre
Alltagstauglichkeit bewiesen hatten, kamen auch schon motorisierte Fahrzeuge zur
Lastenbeförderung auf die Straßen. Zunächst stellten sie für die Eisenbahn,
den damaligen Hauptverkehrsträger, noch keine Konkurrenz dar. Mit wachsender
Leistungsfähigkeit der Lkw gingen der Bahn jedoch immer mehr Marktanteile am Gütertransportaufkommen
verloren. Diese Entwicklung begann zwar schon in den 30er Jahren, doch erst in
den Fünfzigern verstärkten sich die Tendenzen der ständigen Erweiterung des
nationalen Fuhrparks für die Güterbeförderung auf der Straße so auffällig,
dass es durchaus gerechtfertigt erscheint, diese rasante Entwicklung mit einem Rückblick
auf die letzten 50 Jahre Güterkraftverkehr
zu würdigen.
Anfang der 50er Jahre spielten motorbetriebener Fahrzeuge zur Lastenbeförderung bereits eine entscheidende Rolle beim Wiederaufbau und beim beginnenden “Wirtschaftswunder”.
|
1952 |
Bestand:
492 608 Lkw und 141 732 Lkw -Anhänger. |
Die Erhöhung der Nutzlast führte zwangsläufig innerhalb kurzer Zeit zur Erhöhung der Achszahl und dem Einsatz größerer Motoren. Noch vor Beginn der 60er Jahre wurden die Transportfahrzeuge permanent technisch weiter entwickelt. Es entstanden u. a. neue Lenksysteme mit zwei lenkbaren Vorderachsen. Das führte zur Entwicklung neuer Vorschriften. Die zunehmenden Abmessungen mussten begrenzt werden, denn übergroße Lkw oder Lastzüge mit zwei Anhängern stellten bei den damaligen Straßenverhältnissen ein unkalkulierbares Verkehrssicherheitsrisiko dar.
|
1962 |
Bestand:
758 772 Lkw (Zuwachs: + 77 Prozent), 13 828
Sattelzugmaschinen, 164 347 Lkw-Anhänger (Zuwachs: + 16
Prozent) und 9 220 Sattelanhänger. |
Die Weiterentwicklung der Logistik stellte neue Anforderungen an die Infrastruktur und den Gütertransport. 1962 wurde weltweit das erste befahrbare Hochregallager gebaut. Die zunächst manuell bedienbaren Systeme wurden immer weiter verfeinert. Der Einsatz des ersten Mikroprozessors revolutionierte 1972 die Elektrotechnik. Heute übernehmen auf dieser Basis weiterentwickelte Computer die komplette Lagerhalterung einschließlich Be- und Entladung von Transportmitteln und die Überwachung mit Störungsmeldungen.
|
1972 |
Durchbruch
der Sattelfahrzeuge: Bestand: 1 107 181 Lkw (Zuwachs: + 46
Prozent), 42 790 Sattelzugmaschinen (Zuwachs: + 209 Prozent),
217 137 Lkw-Anhänger (Zuwachs: + 32 Prozent) und 46 324
Sattelanhänger (Zuwachs: + 402 Prozent). |
Einen noch größeren Einfluss auf den Gütertransport hatte die Einführung standardisierter Container. Werften, Häfen, Reedereien, aber auch die Bahn sowie Spediteure und Fuhrunternehmer setzen 20-Fuß-Metallboxen ein. Die Idee, Güter in “Blechkisten” zu transportieren, geht ebenfalls bereits auf die 30er Jahre zurück. Die Vorzüge dieser einheitlichen Transportbehälter (schneller Umschlag, stabile Verpackung, diebstahlsichere Aufbewahrung) wurden schnell erkannt und bestimmen heute das Geschehen auf allen Umschlagplätzen dieser Welt.
|
1982 |
Frei
nach dem Hucke-Pack-Prinzip mit dem Container über Land: Bestand: 1 290 809 Lkw (Zuwachs: + 17 Prozent), 60 772 Sattelzugmaschinen (Zuwachs: + 42 Prozent), 233 639 Lkw-Anhänger (Zuwachs: + 8 Prozent) und 69 444 Sattelanhänger (Zuwachs: + 50 Prozent). |
Neue logistische Überlegungen und Kostenzwänge führten zur Lagerhaltung auf der Straße. Kolonnen von Last- und Sattelzügen prägen das Geschehen auf dem Asphalt. Tag und Nacht sind “Brummis” auf den Autobahnen unterwegs, die ihre Ladung schnell und exakt terminiert zu den Produktionsstätten und Verbraucherzentren bringen. Es kommt zum Sonntagsfahrverbot für Nutzfahrzeuge.
|
1992 |
Die
Auswirkungen der Lagerhaltung auf der Straße: Bestand: 1 825 135 Lkw (Zuwachs: + 41 Prozent), 111 516 Sattelzugmaschinen (Zuwachs: + 83 Prozent), 365 415 Lkw-Anhänger (Zuwachs: + 56 Prozent) und 109 952 Sattelanhänger (Zuwachs: + 58 Prozent). |
Als Ergänzung zum Gütertransport auf der Straße laufen bei immer dichterem Verkehrsaufkommen starke Bemühungen, größere Anteile wieder auf die Schiene zu verlagern. Die Bewegungen im Güterverkehr mit deutschen Lastkraftfahrzeugen (Lkw ab 3,5 t Nutzlast und Sattelzugmaschinen) beliefen sich im vergangenen Jahr auf insgesamt 417,5 Millionen Fahrten bzw. 29,0 Milliarden zurückgelegte km. Im Laufe der letzten 6 Jahre haben die Fahrten zwar um 15,9 Prozent abgenommen, die zurückgelegten Strecken sind im Gegensatz dazu aber um 11,2 Prozent gestiegen. Die relativ geringe Distanz von durchschnittlich ca. 70 km spiegelt den hohen Anteil von Transportern für Zuliefer-, Sammel- und Verteilfahrten wieder. Die Dominanz des Lkw in der Flächenbedienung kann derzeit auch von keinem anderen Verkehrsmittel oder –system angegriffen werden.
|
2002 |
Heute: ·
Bestand: 2 649 097
Lkw (Zuwachs: + 45 Prozent), 177 884 Sattelzugmaschinen
(Zuwachs: + 60 Prozent), 673 530 Lkw-Anhänger (Zuwachs: + 84
Prozent) und 221 255 Sattelanhänger (Zuwachs: + 101 Prozent). ·
Über die Hälfte der Lkw
sind Kleintransporter (siehe Grafik). ·
4,6 Prozent der Lkw verfügen
über ein Ladegerät, 7,2 Prozent haben eine Kippvorrichtung und 5,9
Prozent sind mit einem Spezial-Aufbau ausgestattet. ·
Die meisten Lkw wurden in
den industriestarken Bundesländern Nordrhein-Westfalen (19,2 Prozent),
Bayern (14,5 Prozent) und Baden-Württemberg (11,6 Prozent)
angemeldet. ·
10,8 Prozent der Lkw sind im
Baugewerbe eingesetzt. ·
Das Durchschnittsalter beträgt
ähnlich wie bei den Pkw 7,2 Jahre. · Das durchschnittliche Alter der Lkw, die abgemeldet werden und damit aus den Dateien des Fahrzeugregisters gelöscht werden, beträgt 10,6 Jahre (Pkw: 11,8 Jahre). |
Schwere Lkw verursachen in besonderem Maße Kosten für den Bau, die Erhaltung und den Betrieb von Autobahnen. Die Belastung der Straßen durch einen schweren Lkw mit 40 Tonnen Achslast ist etwa 60 000 mal größer als durch einen Pkw. Die Bundesregierung verfolgt deshalb im Einklang mit der EU-Verkehrspolitik das Ziel, durch eine verursachergerechte Anlastung der Wegekosten den Lkw stärker an der Finanzierung der Infrastruktur zu beteiligen. Deswegen soll beim Lkw ein Systemwechsel vollzogen werden – weg von der alleinigen Finanzierung über Steuer und Eurovignette und hin zu einer Nutzerfinanzierung durch eine streckenbezogene Lkw-Gebühr (“Maut”). Die Gebühr bringt zusätzliche Einnahmen, die für den Erhalt und den weiteren Ausbau der Verkehrswege in Deutschland dringend erforderlich sind (Ausbau der Straße, Schiene und der Wasserstraßen). Bahnen und Binnenschiffe erhalten eine Chance, mehr Güterverkehr von der Straße vor allem auf die Schiene zu verlagern.
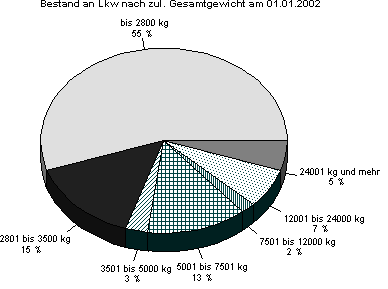
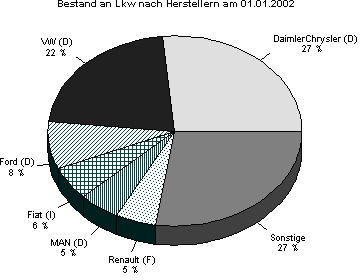
Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt (Flensburg, 26.07.2002)